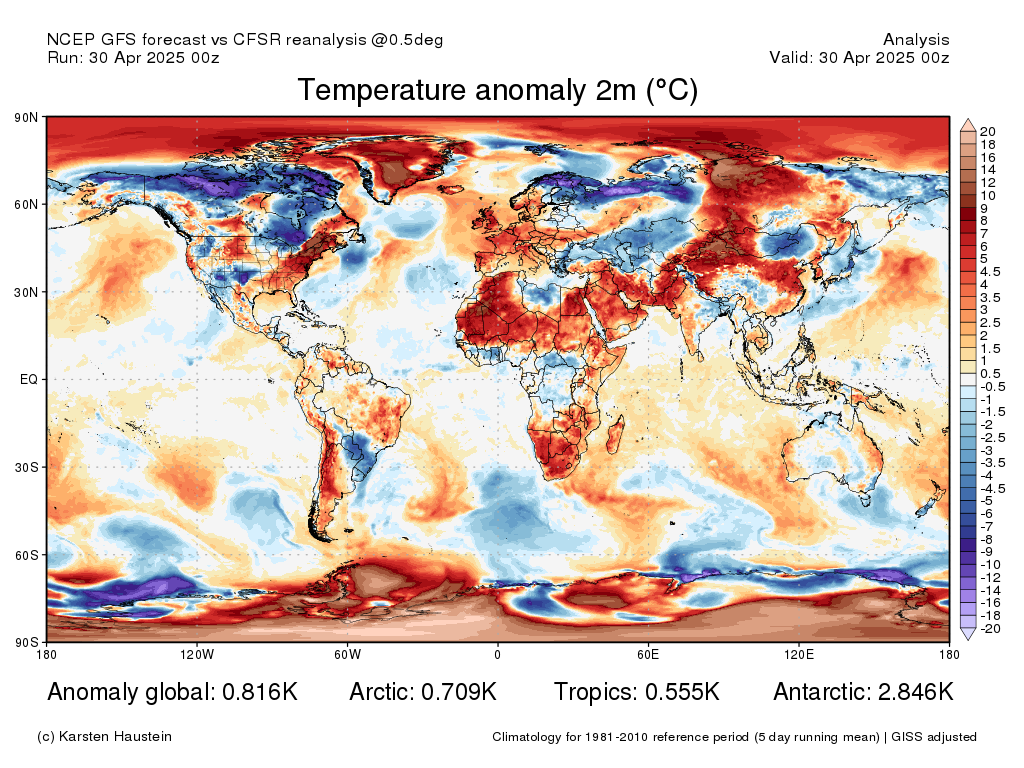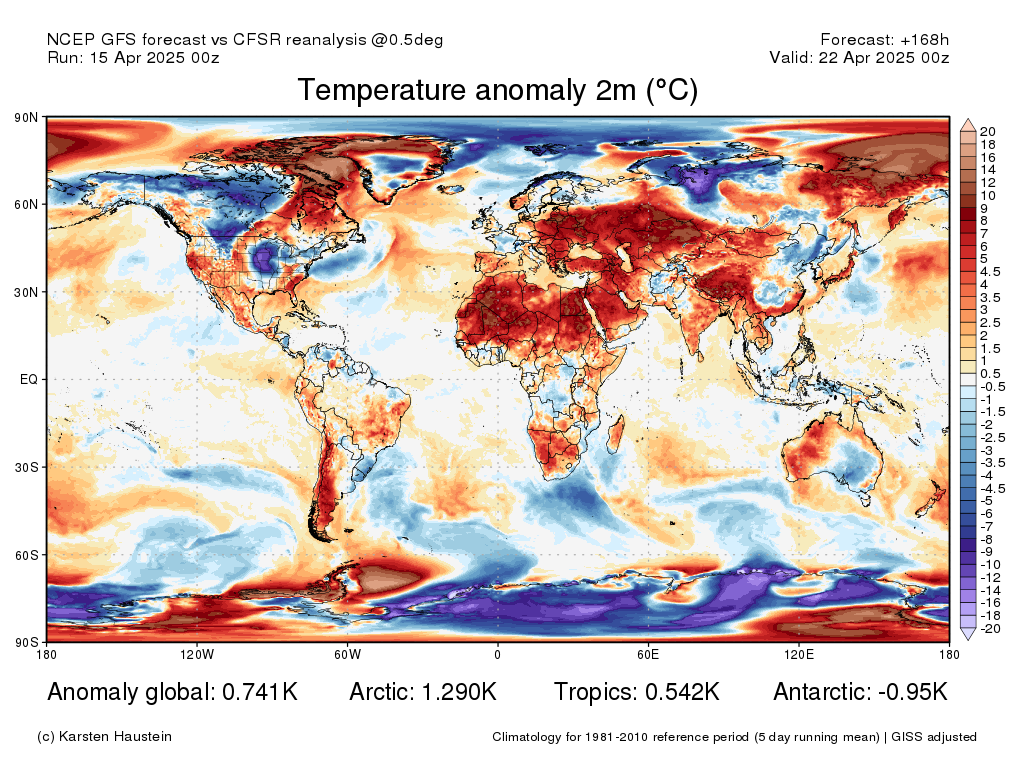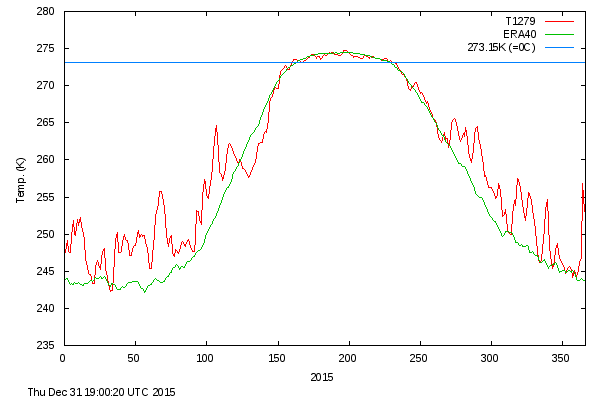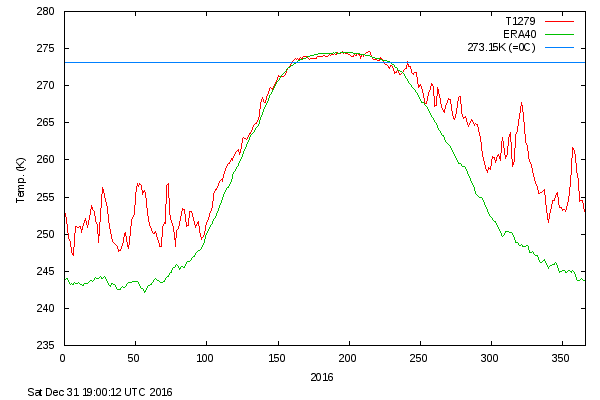Ich stelle mir das ähnlich wie bei Leewellen vor, bei denen durch Dissipationsenergie (also Wärme und Turbulenz) infolge von Wellenbrechung in etwas Abstand zum Gebirge in höheren Luftschichten CAT (Clear Air Turbulence, spürbar durch Turbulenz beim Fliegen) auftritt, nur in ungleich größeren Skalen.
Phänomenologisch stelle ich mir die Auswirkungen wie folgt vor:
Die Erwärmung in der Stratosphäre bei major warmings ja ist bis in die Troposphäre hinein erkennbar (100,200hPa). Durch die Wärme stabilisiert sich der obere Teil der Troposphäre, es kommt zu großflächiger Subsidenz (Absinkbewegung) und begünstigt somit die Entstehung eines semipermanenten Hochdruckgebietes, eben eines blockierenden Hochs, als steuerndes System. Klarerweise spielen auch noch viele andere Faktoren bei der Hochdruckbildung eine Rolle, daher kann man nicht sagen, dass sich das blockierende Hoch genau unterhalb der stärksten stratosphärischen Erwärmung bildet.
Dynamisch kann man das ganze sicherlich gut mit der IPV-Theorie (isentrope potentielle Vorticity) beschreiben. Allerdings habe ich keinen Überblick zu wissenschaftlichen Arbeiten auf diesem Gebiet.
Das Brechen wäre jedenfalls ein nichtlinearer Effekt. Nichtlineare Effekte sind nur sehr schwer qualitativ zu beschreiben, sind allerdings durch die Modellphysik in dieser Größenordnung abgedeckt und somit von Globalmodellen in der Vorhersage ausreichend erfasst. Mehr noch, durch die geringe Wellenzahl reicht die Skala auch bis in Saisonprognosen hinein, welche meiner subjektiven Gefühl nach immer öfter diese Blockinglagen auch drin haben.
Kennt jemand Untersuchungen zur Klimatologie solcher Blocking-Lagen bzw der Untersuchung der Lage der blockierenden Hochs im Vergleich zu den Stratospheric Warmings?
Ich wäre für Meinungen, Ergänzungen, eigene subjektive Beobachtungen, andere Interpretationen, Kritik usw. sehr dankbar. Auch Feedback darüber, ob mein Kommentar halbwegs verständlich verfasst ist, würde ich sehr begrüßen.